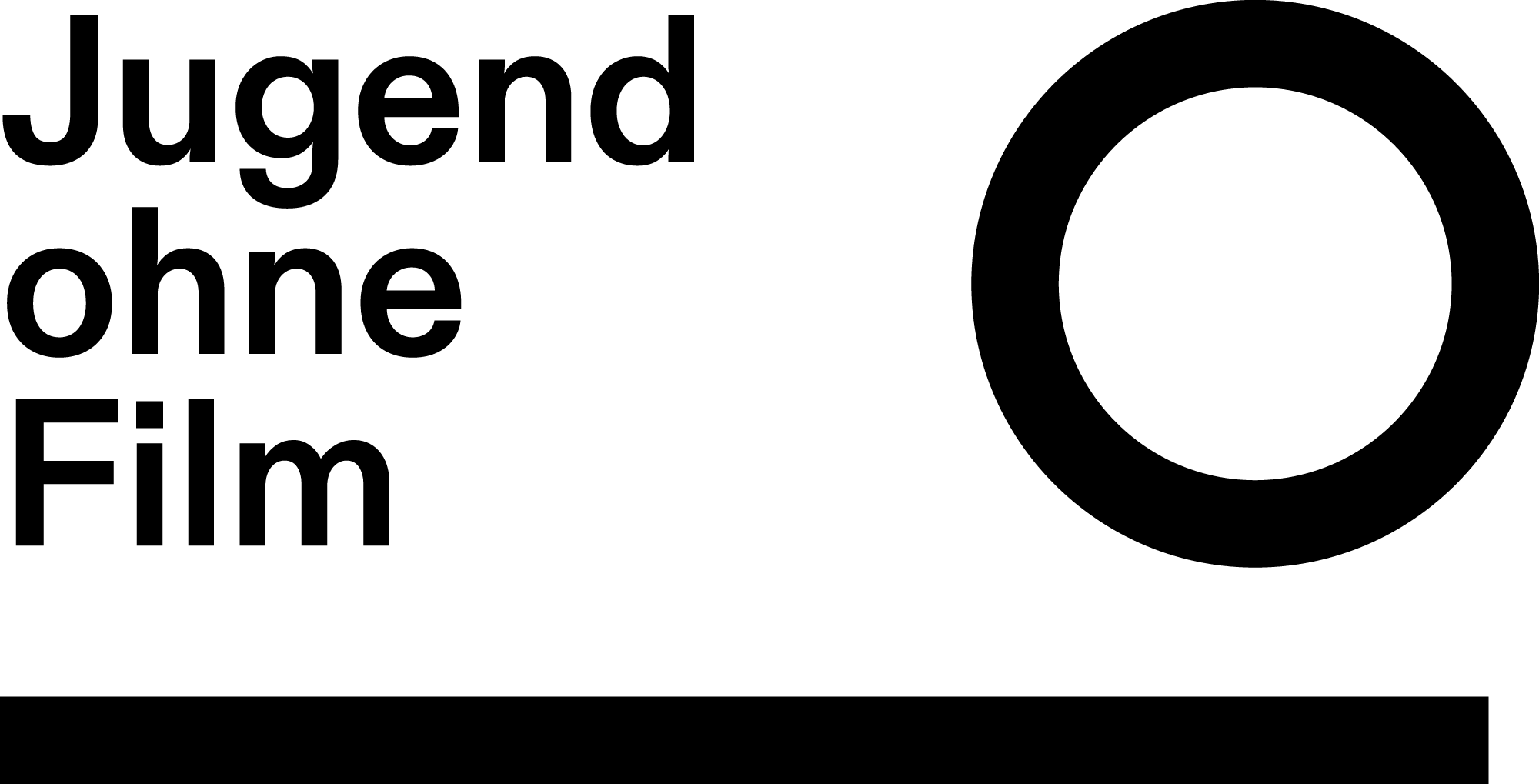Kindheit
-
Kein Bedarf für Posamenten (Etalagen III)
Licht hatte hier noch nie gebrannt. Es ist eines dieser Geschäfte an stetig befahrenen Straßen, wo man zwar täglich vorübergeht, doch in Eile geraten, sie kaum wahrnehmen kann. Um überhaupt das Angebot zu begreifen, müsste man auf einen einsamen Zeitpunkt ohne den drängelnden Fußverkehr warten, jenseits üblicher Öffnungszeiten. Bestenfalls bei Regen oder nachts, wenn nicht…