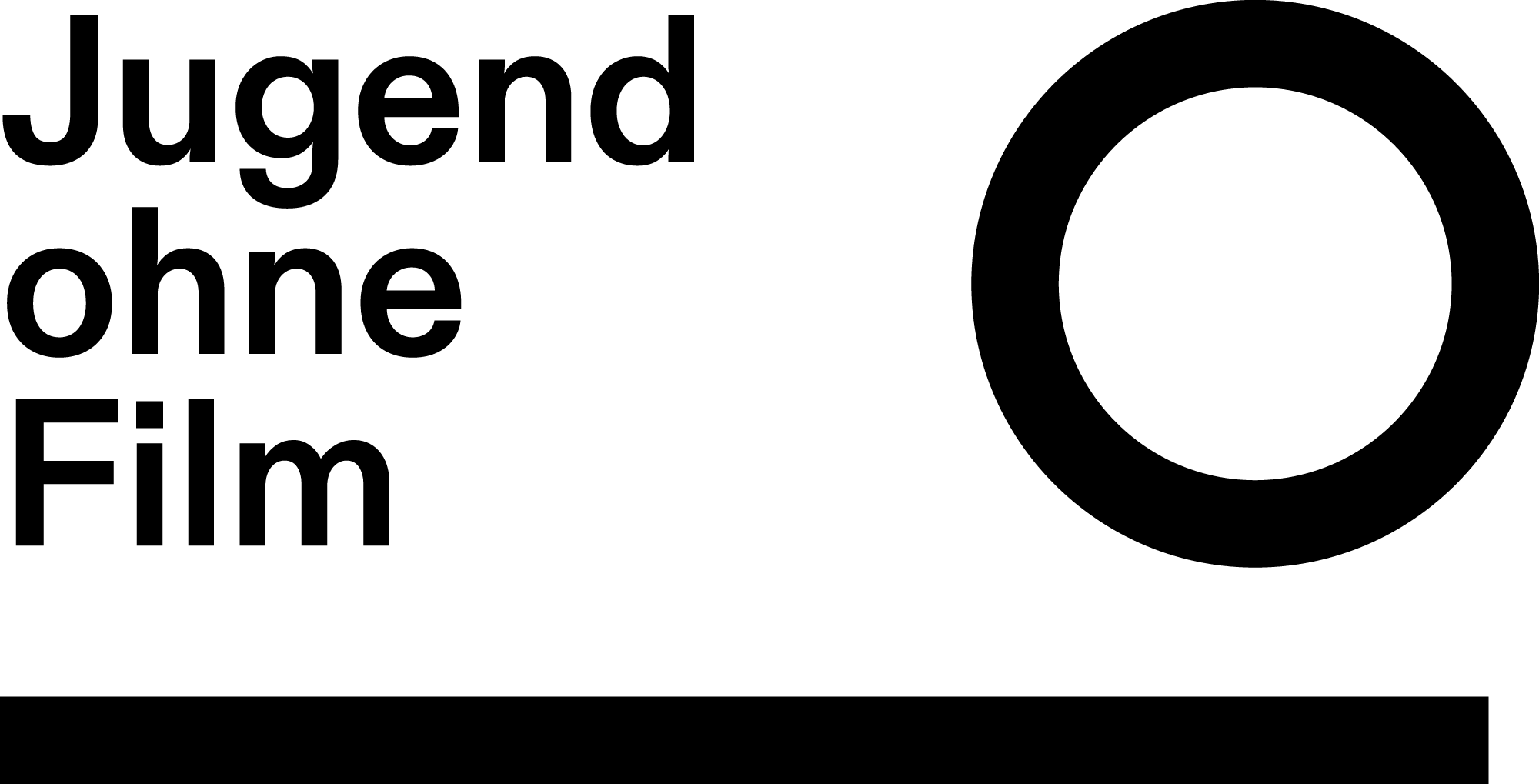Vergessen
-
Hin und wieder, Vergessen im Kino
Wann beginnt man, über einen gesehenen Film nachzudenken? Zumeist legen sich schon während des Abspanns andere Gedanken über die abflachende Konzentration. Weniges stiftet dazu an, unmittelbar nach dem Verlassen des Kinos, etwas zu notieren und festzuhalten. Der Film bleibt an seinem Ort, während ich mich von ihm entferne. Das Gespräch mit einem Freund im Anschluss…