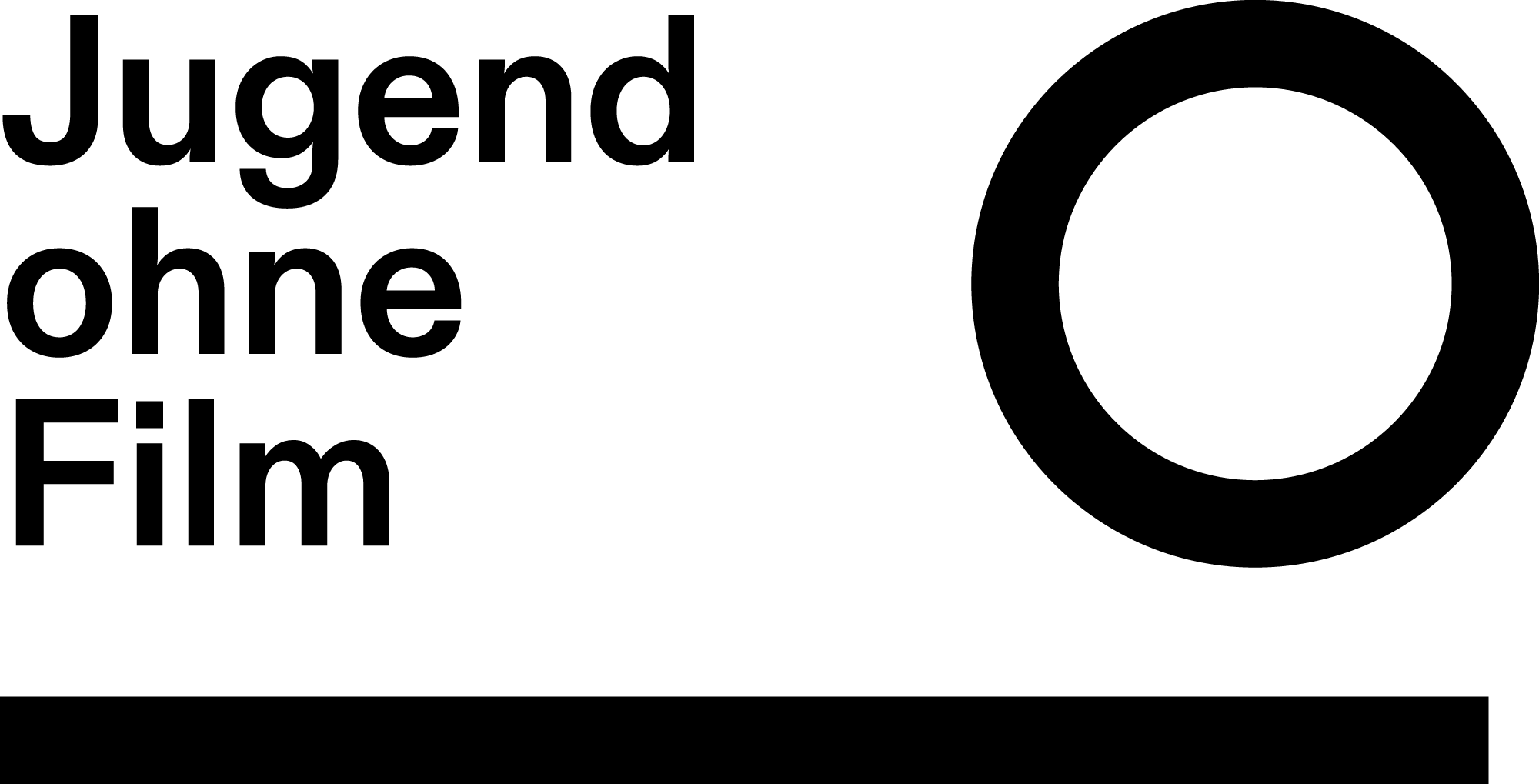Serge Daney
-
On films that end – Julia Loktev’s The Loneliest Planet and Shinji Aoyama’s Eureka
„J’ai effectivement l’impression qu’il y avait dans les films d’il y a cinquante ans un art de la brièveté, de la condensation des événements, des idées, vertigineux et qui a été complètement perdu, parce que il y a des époques pour toutes les choses, enfin, parce qu’on est passé, comme le dirait Deleuze, dans une…