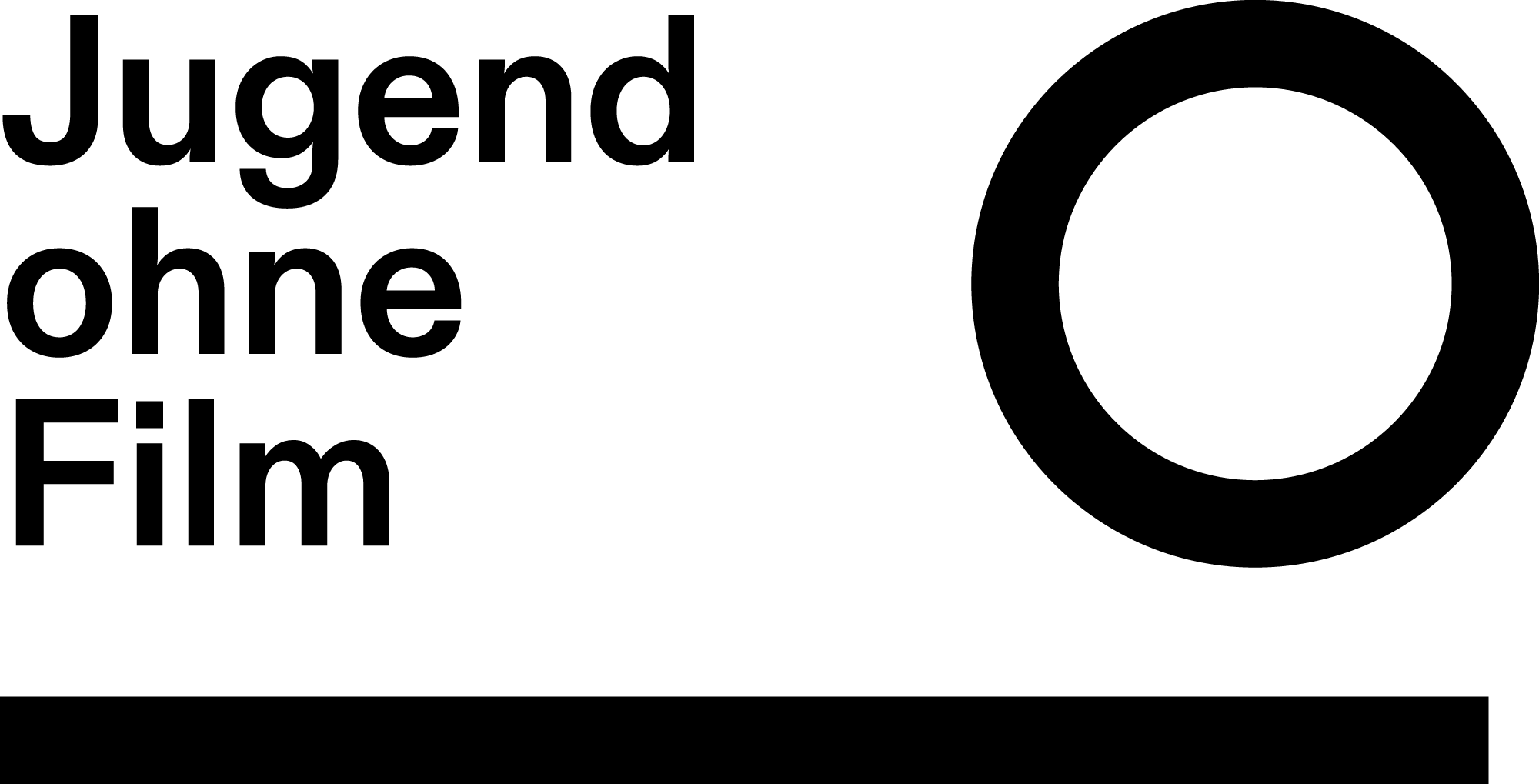BLOG
-
Notiz zu Hell in the Pacific von John Boorman
Die Welt ist eine Insel. Zumindest immer dann, wenn ein Ausweg notwendig, jedoch unmöglich scheint. So zum Beispiel in John Boormans zweiten Hollywoodfilm Hell in the Pacific, in dem zwei verfeindete Soldaten im Zweiten Weltkrieg auf einer einsamen Pazifikinsel umgeben von brandenden Wellen, ein paar Bäumen und leicht zu fangenden Fischen – sonst weiter nichts…