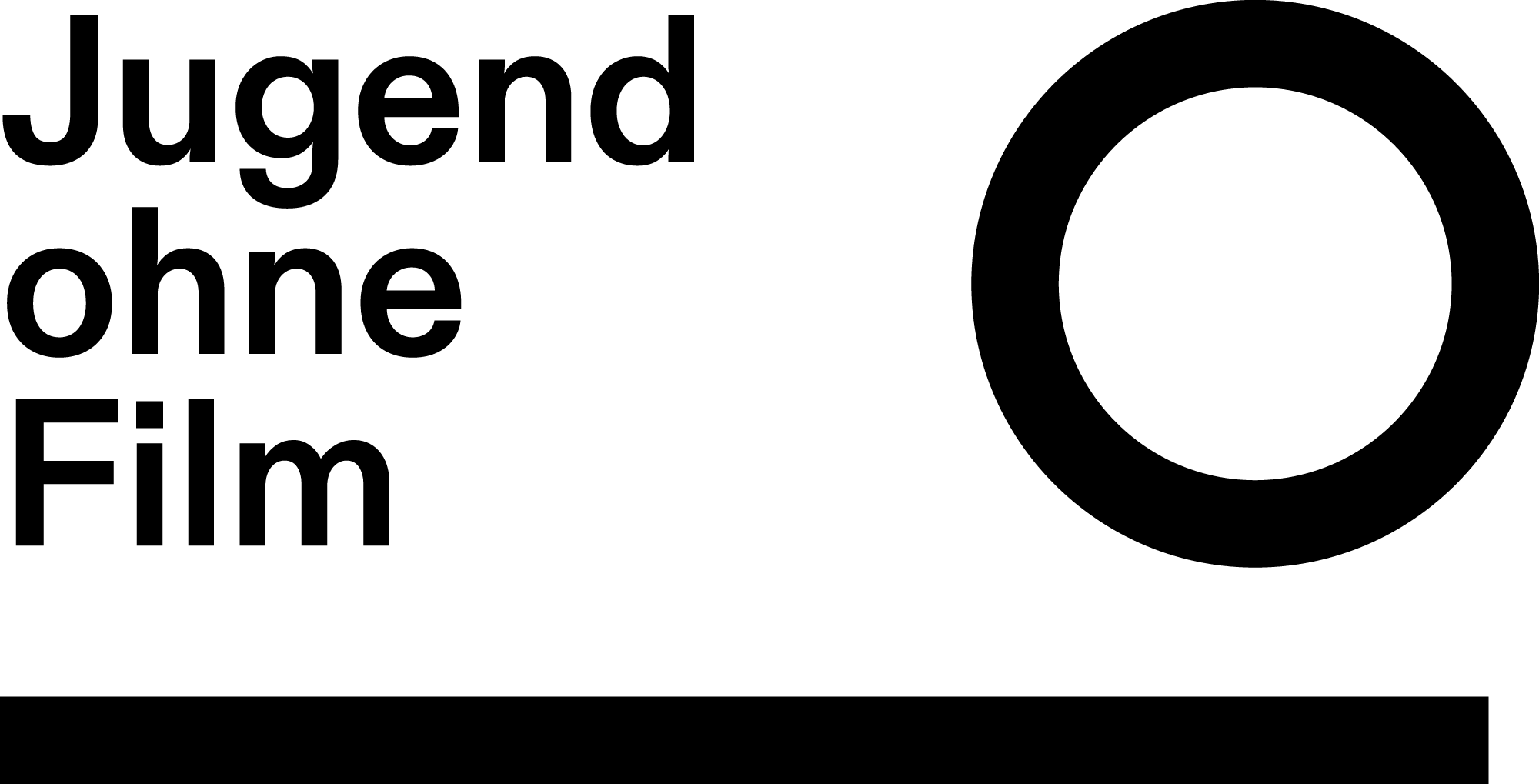Kino
-
Schneekino
Hätte nichts dagegen, wären alle Filme im Schnee gedreht. So könnte ich die Bewegungen der Menschen besser sehen, denn sie wären schwerfälliger, bedachter. Die Flüchtigkeit läge unter einer Decke, sie könnte nicht fliehen, wie sie es sonst so gerne tut. Licht bräche diffus, es würde in alle Richtungen über die Leinwand strahlen und so weiter.…