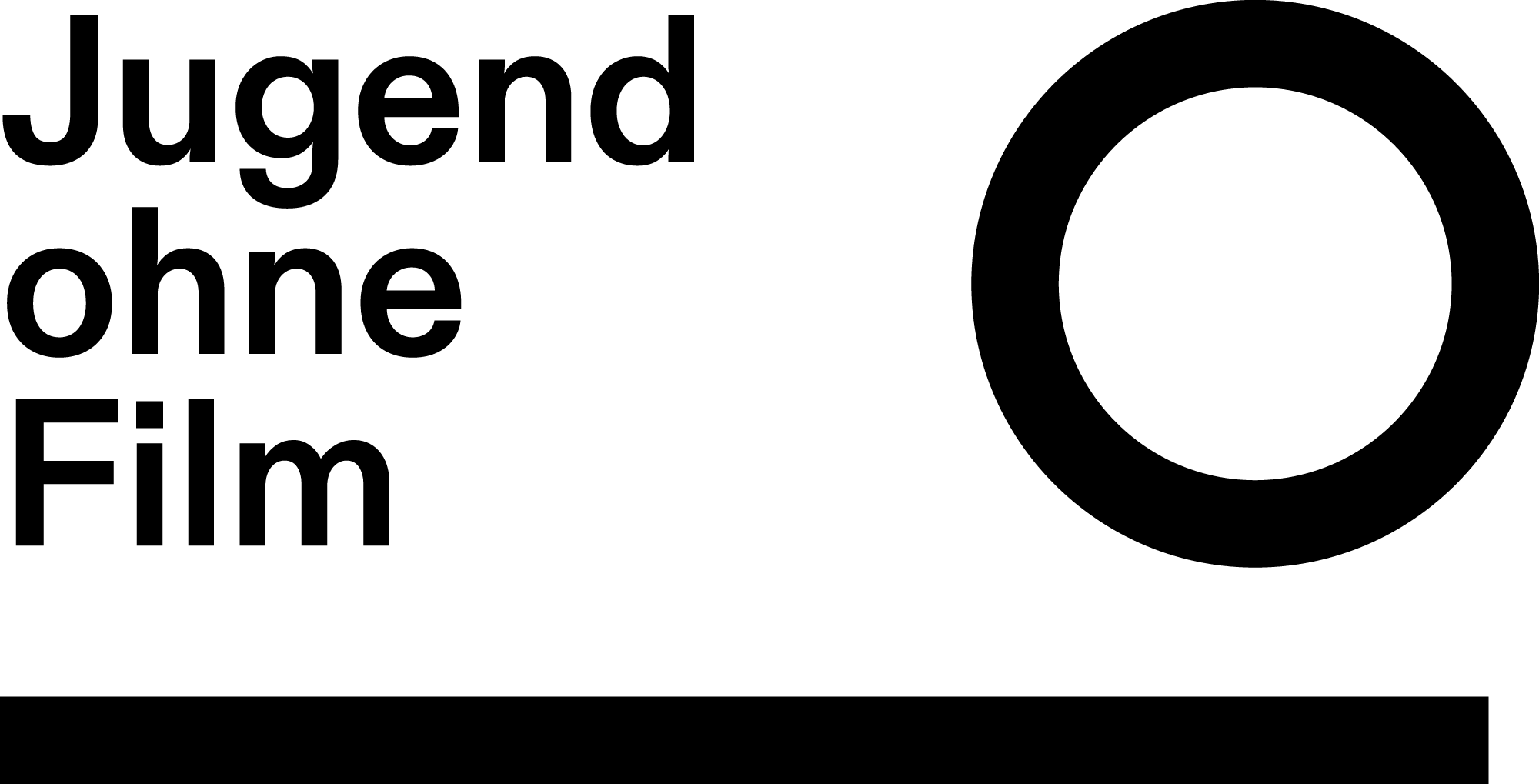Mythos
-
Notiz zu The Human Hibernation von Anna Cornudella Castro
In der Ferne ein rotes Leuchten im Nebel. The Human Hibernation von Anna Cornudella Castro beginnt bei Tauwetter. Ein kleiner Junge irrt durch einen winterlichen Wald, sucht seine Begleiter, um ihn herum Kühe, die ihre Blicke auf ihn richten. Er erreicht einen von Bäumen umstellten Teich, wo er verzweifelt in den schweren Schnee sinkt und…