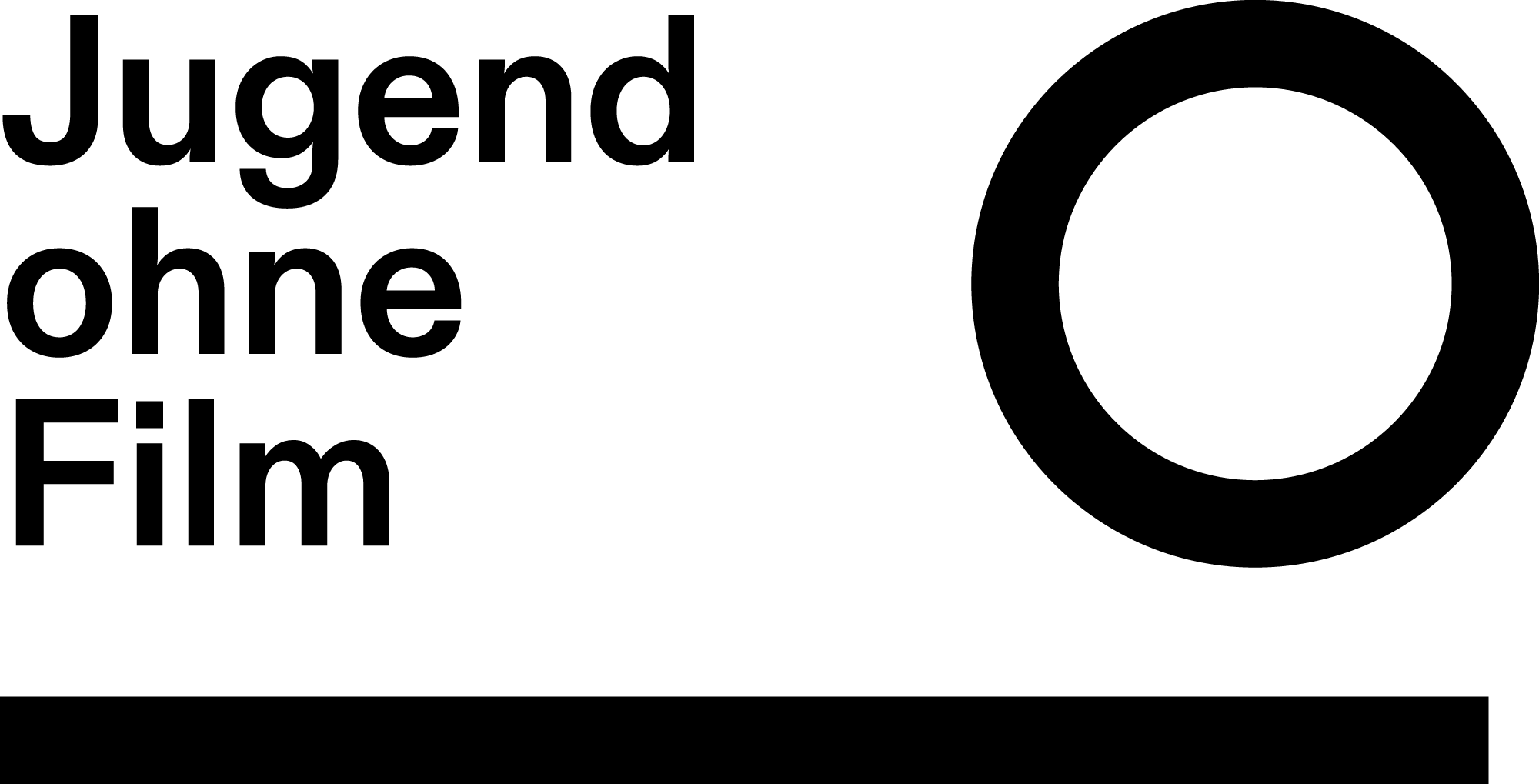Retrospektive
-
Notiz zu Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen von Eva Hiller
Ob sich in der Nacht Unvorhergesehenes, Ungeahntes, aber doch Ersehntes zu erkennen gibt, wird sich erst erfahren lassen, wenn sie vorüber gegangen ist. Dies könnte sowohl für Eva Hillers einzigartigen Film Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen gelten als auch für die Retrospektive der diesjährigen Berlinale. In erste Linie ist es die…